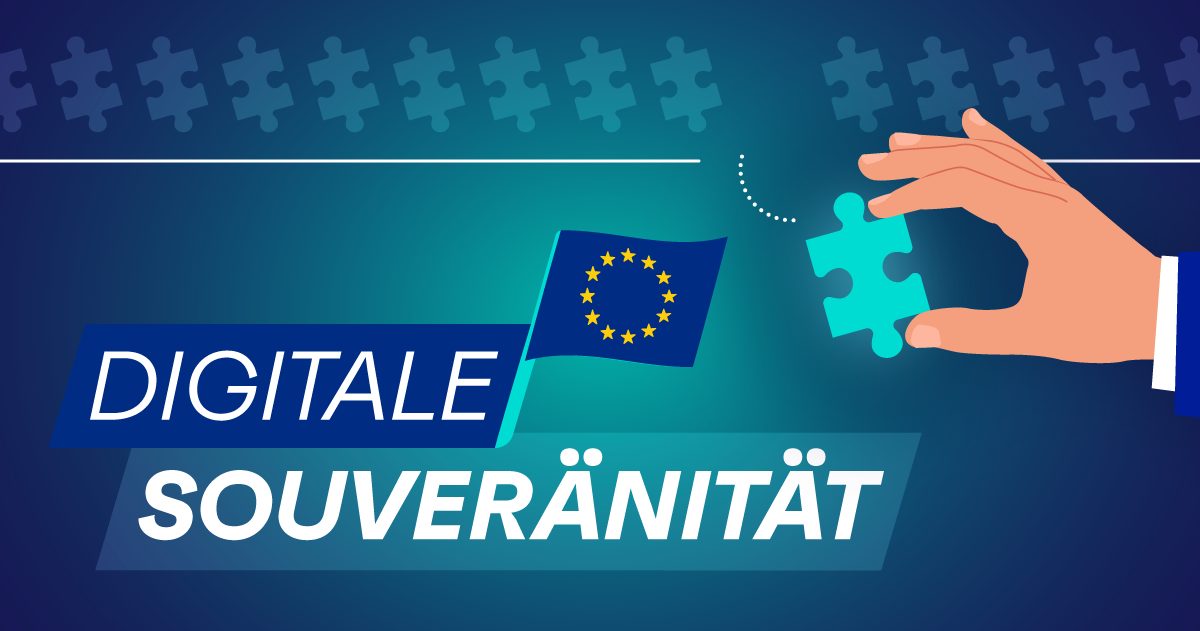
Veröffentlicht 3. Juli 2025
von Thorsten Greiten
Digital Independence Day – warum Europa digitale Souveränität braucht
Die geopolitischen Spannungen nehmen zu – und das Schlachtfeld verlagert sich zunehmend in den digitalen Raum. Was passiert, wenn die USA europäischen Unternehmen den Zugang zu essenziellen Tech-Diensten verweigern? Der Beitrag zeigt ein realistisches Szenario digitaler Abhängigkeiten – und wie Unternehmen ihre digitale Souveränität stärken können.
Digitale Souveränität als strategischer Imperativ
Die Welt verändert sich rasant. Kriegerische Konflikte, wirtschaftliche Unsicherheiten und technologische Abhängigkeiten sorgen für tiefgreifende Umwälzungen. Die Digitalisierung ist längst zu einem geopolitischen Machtfaktor geworden. Inmitten dieses Szenarios gießt Donald Trump mit seiner unberechenbaren Politik weiter Öl ins Feuer – zuletzt mit neuen Sonderzöllen und milliardenschweren Investitionen in US-Tech-Infrastruktur.
Ein von Datenexperte Stefan Werner angestoßenes Gedankenexperiment auf LinkedIn bringt die Debatte auf den Punkt: Was, wenn die USA ihre Tech-Dienste für Europa abschalten?
Szenario: Digitale Eskalation in vier Akten
1. Blockade sozialer Netzwerke:
Eine erste Eskalationsstufe könnte die Sperrung von Plattformen wie LinkedIn, Facebook, Instagram oder YouTube sein. Private Kommunikation, berufliche Netzwerke und unternehmerische Reichweitenstrategien wären massiv eingeschränkt. Zwar gäbe es Alternativen – doch Transferkosten und Unsicherheit wären erheblich. Der politische Druck auf die EU würde steigen.
2. Ausfall der Geschäftskommunikation:
Dienste wie Microsoft 365, Zoom oder Slack sind essenziell für viele europäische Unternehmen. Ein Ausfall würde Entscheidungsprozesse verlangsamen, Produktivität brechen und Mitarbeitende zurück in starre Bürostrukturen zwingen. Beim Wechsel zu Alternativen drohen Sicherheitslücken – und die bürokratische Trägheit Europas erschwert schnelle Reaktionen.
3. Zusammenbruch des Online-Handels:
Zahlungsdienste wie PayPal oder Apple Pay könnten blockiert werden, ebenso mobile Betriebssysteme wie iOS und Android. Die Folge: E-Commerce bräche ein, digitale Services würden unzugänglich, Sicherheitslücken blieben ungepatcht. Die politische Eskalation wäre nicht mehr zu übersehen.
4. Angriff auf die digitale Infrastruktur:
Ein Ausschluss Europas von zentralen Internetdiensten – etwa über Änderungen an der Root-Zone des Domain Name Systems (DNS) – würde das Internet, wie wir es kennen, dauerhaft verändern. Die Sperrung europäischer Domains, der Entzug von HTTPS-Zertifikaten oder das Umleiten von Backbone-Verbindungen wäre ein Akt hybrider Kriegsführung mit globalen Folgen.
Digitale Souveränität sichern: Sieben Handlungsfelder
1. Resilienz strategisch aufbauen
Business-Continuity-Pläne müssen geopolitische Risiken explizit einbeziehen. Darksites, alternative Server-Standorte und klare Notfallprozesse helfen bei der Absicherung.
2. Cloud-Abhängigkeiten reduzieren
Hybride und Multi-Cloud-Modelle mit europäischen Anbietern machen Unternehmen unabhängiger. Kritische Pfade müssen analysiert und gegebenenfalls angepasst werden.
3. Open Source fördern
Offene Technologien bieten mehr Kontrolle und Flexibilität. Der Umstieg erfordert Investitionen – zahlt sich aber durch Unabhängigkeit und Anpassungsfähigkeit langfristig aus.
4. Verträge und Datenflüsse prüfen
Wo liegen die Daten? Welche Exit-Klauseln gibt es? Wer haftet im Ernstfall? Unternehmen müssen ihre Verträge und Datenflüsse regelmäßig juristisch und technisch evaluieren.
5. Technologisches Know-how intern sichern
Eigene IT-Kompetenz schützt vor Abhängigkeit. Krisenszenarien sollten regelmäßig geübt werden – inklusive Ausfall zentraler US-Dienste.
6. Kooperationen nutzen
Initiativen wie Gaia-X oder CISPE schaffen Standards für digitale Souveränität und fördern branchenübergreifenden Austausch.
7. Cybersicherheit ausbauen
Frühwarnsysteme, kontinuierliche Verbesserungen bei Verschlüsselung und Backup-Strategien sind essenziell für die digitale Verteidigungslinie.
Digitale Souveränität ist Bürgerpflicht
Ein plötzlicher Systemwechsel würde Europa unvorbereitet treffen – wirtschaftlich, gesellschaftlich und technologisch. In der Übergangszeit gäbe es erhebliche Einbußen. Doch langfristig könnten wir lernen, unsere digitale Infrastruktur unabhängiger und robuster zu gestalten.
Digitale Souveränität ist keine Vision für eine ferne Zukunft, sondern eine Notwendigkeit der Gegenwart. Wer in der digitalen Welt bestehen will, muss Kontrolle zurückgewinnen – über Daten, Systeme und Kommunikationswege. Der Digital Independence Day könnte der Tag sein, an dem Europa Verantwortung übernimmt.
Dipl.-Kaufm. Thorsten Greiten (50) studierte BWL mit den Schwerpunkten Steuerlehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Mannheim. Er ist Geschäftsführer bei NetFederation und fachlich verantwortlich für den Bereich Digitale Finanz- und Krisenkommunikation. Seit 2003 untersuchen er und sein Team von Spezialisten alljährlich die digitalen Auftritte von Unternehmen aus DAX40, MDAX und TecDAX. Mittlerweile wurden Tausende von einzelnen Websites und Social-Media-Präsenzen mit fast 2,6 Mio. Einzelbewertungen analysiert. Die Ergebnisse dieser Analysen sind bereits in zahlreiche Publikationen, Artikel und Studien eingeflossen. Zudem ist Greiten seit 2022 als Lektor mit der Vorlesungsreihe „Digitale Investor Relations“ im Department Digital Business und Innovation für die Fachhochschule St. Pölten tätig.
Sein Antrieb: Innovative Kommunikationslösungen gemeinsam mit Kund:innen entwickeln.
Du willst mehr erfahren?
Thorsten Greiten freut sich von dir zu hören: thorsten.greiten@net-federation.de.








